Herzlich willkommen bei der Synagogengemeinde Saar
Liebe Besucher unserer Homepage – wir freuen uns über das Interesse an unserer Gemeinde und möchten Sie über die Geschichte der Juden an der Saar ebenso informieren, wie auch über aktuelle Themen. Nehmen Sie sich etwas Zeit und schauen Sie sich auf unseren Seiten um.
Sollten Sie Anregungen, Fragen oder gar Kritik haben, so lassen Sie es uns wissen. Am einfachsten über das Kontaktformular.
Geschichte
Juden kamen wohl mit den römischen Legionen in die damaligen germanischen Provinzen und siedelten sich entlang von Rhein, Mosel und Saar an.
Kurse
Die Synagogengemeinde Saar bietet verschiedene Kurse für unsere Gemeindemitglieder sowie Freunde der Gemeinde an.
Führungen
Über 1500 Menschen besuchen jedes Jahr unsere Synagoge im Rahmen von Führungen! Melden Sie sich gerne für eine Führung an.
Aktuelles
Jüdische Menschen sind entsetzt über Interview in der Saarbrücker Zeitung
Gemeinsame Stellungnahme der Synagogengemeinde Saar und der Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft des Saarlandes (CJAS) Wir als Synagogengemeinde des Saarlandes möchten gemeinsam mit
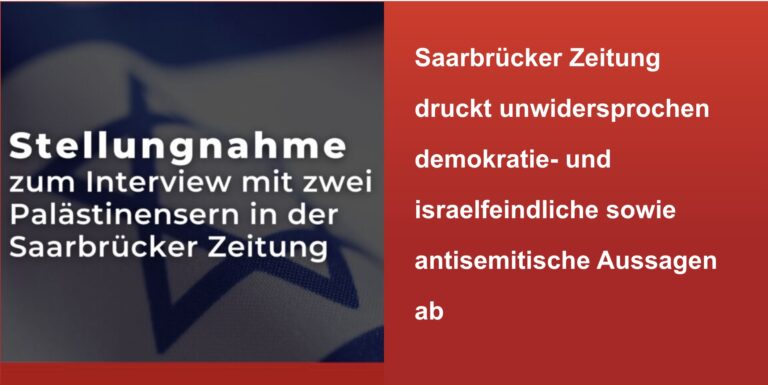
Saarbrücker Zeitung druckt unwidersprochen demokratie- und israelfeindliche sowie antisemitische Aussagen ab
Stellungnahme zum Interview mit zwei Palästinensern in der Saarbrücker Zeitung Saarbrücken – Mit großem Entsetzen haben wir das Interview unter dem Titel

Marsch des Lebens
So. 05.05.24 | Saarbrücken 14:30 Uhr: Sammlung am Platz der Erinnerung, vor der Synagogengemeinde Saar, Lortzingstraße 8 14:50 Uhr: Gemeinsamer
Spenden
Die Synagogengemeinde Saar übernimmt gesellschaftliche und soziale Aufgaben. Aber die vielfältigen Aufgaben erfordern immer weitere finanzielle Mittel. Daher ist die Synagogengemeinde auch auf private und institutionelle Spenden angewiesen.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die verschiedene Projekte der Synagogengemeinde und sichern damit auch den Aufbau und das Überleben der jüdischen Kultur und Ihrer Traditionen in Saarbrücken und ganz Saarland. Jeder Spender kann auch eine Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt bekommen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre Spende an uns zu übermitteln:
Überweisung
Richten Sie bitte Ihre Überweisung an das Konto der Synagogengemeinde unter Angabe des Spendenzwecks:
Sparkasse Saarbrücken
IBAN: DE69 5905 0101 0067 1079 38
PayPal
Spenden Sie via PayPal, als einmalige oder monatliche Spende. Sie können auch mittels einer Debit- oder Kreditkarte spenden, ohne einen PayPal-Account zu besitzen oder zu eröffnen.
G'ttesdienst
Ab 29. Oktober 2023 stellen wir auf Winterzeit um.
Der G’ttesdienst am Freitagabend beginnt in der Winterzeit um 18:00 Uhr.
FAQ
Kann ich die Synagoge spontan besichtigen?
Wie kann ich an Veranstaltungen der Jüdischen Gemeinde teilnehmen?
Ist die Jüdische Gemeinde Saar eine orthodoxe Gemeinde?
Die Jüdische Gemeinde Saar ist eine Einheitsgemeinde. Alle Strömungen sind willkommen.
